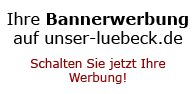Das besondere an den Romanen von Juli Zeh ist die Realitätsnähe, die klare Sprache und der Unterhaltungswert ihrer Bücher.
Mit „Über Menschen“ hat sie einen neuen Dorfroman geschrieben, der wie ihr erfolgreicher Vorgänger „Unterleuten“ von 2016 in einem fiktiven Dorf im ländlichen Brandenburg spielt. Die Schriftstellerin, ehrenamtliche Richterin und Pferdenärrin weiß, wovon sie spricht: Die aus Bonn gebürtige Autorin lebt seit vielen Jahren mit ihrer Familie in einem Dorf im Havelland.
Diesmal also Bracken in der Prignitz. Ein Name, der sich leicht mit Pflanzkanaken und Polaken reimen lässt, was auch auf die nächste Ebene verweist, nämlich das Klischee der Rechtsradikalen im Osten. Wobei Juli Zeh wunderbar mit diversen Klischees spielt. Da ist zunächst die Hauptfigur Dora, die als progressive Großstädterin von Berlin aufs Land flieht. In Zeiten von Klimawandel und Corona geht es zunächst darum, was die Krise mit Menschen macht, sowohl privat als auch gesellschaftlich.
Natürlich hat Dora, wie so viele Großstadt-Menschen davon geträumt, romantisch auf dem Land zu leben, mit selbst angelegtem Landhausgarten und Freunden, die zu Besuch kommen und sie um ihre Idylle beneiden. Aber der Anlass ist ein anderer: Ihr Freund Robert mutiert vom Klimaaktivisten zum Corona-Mahner, der ihr immer mehr verbietet und ein schlechtes Gewissen macht.
In Gedanken nennt sie ihn „Robert Koch“, der selbst das Gassi-Gehen mit der Hündin „Jochen-der-Rochen“ unterbinden würde. „Der Gang zur Baumscheibe reiche doch“. Sie wechselt ihm zuliebe sogar die Agentur, wo sie arbeitet. Entwirft einen Werbeauftritt für Öko-Jeans, denen sie das Label „Gutmenschen“ geben möchte, doch als Folge der Pandemie verliert sie nicht nur den Auftrag, sondern auch noch den Job. Corona gibt auch der Beziehung zu Robert den Rest: „Als Robert sagte, dass das Virus in gewisser Weise auch ein Segen sei, weil es den Planeten von der Mobilität befreie, wusste sie, dass sie gehen musste“.
Also kauft sie in Bracken ein runter gekommenes Landhaus mit verwildertem Garten. Gnadenlos scheitert sie wegen Ahnungslosigkeit beim Anlegen eines kleinen Pflanzbeetes. Und auch ihr direkter Nachbar, der sich selbst „Gote“ nennt, begrüßt sie bei der ersten Begegnung mit den Worten: „ Ich bin hier der Dorf-Nazi“. Er säuft, lebt in einem seltsamen Wohnwagen, obwohl er auch ein Haus hat und trifft sich mit Freunden zum Singen des „Horst-Wessel-Liedes“. Gote ist nicht das einzige Dorf-Klischee, mit dem die Autorin lässig spielt. Da gibt es noch den Mann von gegenüber mit der Motorsäge, der hauptsächlich in rassistischen Witzen spricht und eine Schürze mit der Aufschrift „Seriengriller“ trägt. Oder das schwule Pärchen aus Garten-Experte und Kabarettist. Und natürlich klebt am Briefkasten ein AfD-Aufkleber.
Trotz alledem freundet sich Dora langsam mit der Dorf-Gemeinschaft an, besonders mit Franzi, dem 10jährigen wilden Töchterchen von Gote, die ein wahrer Wirbelwind ist und sich ausgiebig um die Mischlings-Hündin „Jochen-der-Rochen“ kümmert. Gote bleibt schweigsam, was wohl an der „Raumforderung“ liegt, die ihn und seinen Schädel so langsam außer Gefecht setzt. Auf dieses Geheimnis kommt Dora mithilfe ihres Vaters, eines berühmten Hirn-Chirurgen an der Charité, der dem „Sportfreund“ seiner Tochter eine ernüchternde Prognose stellt. Schon seit ihrer Kindheit weiß Dora, dass „Raumforderung nicht der Wunsch nach einem eigenen Zimmer, sondern ein bösartiger Tumor ist“. So entspannt sich zwischen den beiden grundverschiedenen Personen so etwas wie eine kurze Beziehung aus Fürsorge und Glück.
 Trotzdem verschweigt Juli Zeh nicht die Bösartigkeit des Mannes und seinen Rassismus, der sich sogar noch gegen die indisch-stämmige Radiologin in der Charité richtet. Sie wertet dies aber nicht ideologisch, sondern eher menschlich. Nicht immer ist klar, wer die Guten und wer die Bösen sind. Denn auch Dora hält sich für was Besseres als ihr Nazi-Freund und wirft ihm das auch an den Kopf, obwohl das eigene Erschrecken darüber sofort klar macht, dass es genau das war, was sie Robert früher vorgeworfen hatte.
Trotzdem verschweigt Juli Zeh nicht die Bösartigkeit des Mannes und seinen Rassismus, der sich sogar noch gegen die indisch-stämmige Radiologin in der Charité richtet. Sie wertet dies aber nicht ideologisch, sondern eher menschlich. Nicht immer ist klar, wer die Guten und wer die Bösen sind. Denn auch Dora hält sich für was Besseres als ihr Nazi-Freund und wirft ihm das auch an den Kopf, obwohl das eigene Erschrecken darüber sofort klar macht, dass es genau das war, was sie Robert früher vorgeworfen hatte.
Am Ende wird aus dem Ganzen sogar noch ein recht versöhnlicher Roman, der selbst den Nazi in das Dorf-Geschehen integriert und um den man gemeinsam trauert. Denn schließlich sind die Dörfler nicht verrückter als die Städter und die Wessis nicht besser als die Ossis. Juli Zeh gelingt mit ihrem neuen Roman ein schönes, trauriges Märchen aus der Prignitz voller Sprachwitz und Humor, der sich locker weg liest, auch wenn er manchmal nur haarscharf am Klischee vorbei schlittert. So dicht am Zeitgeist und absolut passend in Zeiten der Pandemie.
Juli Zeh: Über Menschen, Luchterhand-Verlag München, März 2021, 416 Seiten, Amazon.
Dem Zeitgeist ganz nahe kommt auch meine zweite Roman-Empfehlung. Es handelt sich um das erste Buch der jungen australischen Autorin und Künstlerin Sophie Hardcastle, das auf Deutsch erschienen ist. Ein Roman so tiefgründig wie das Meer, aber so böse und traumatisch, dass man zart besaiteten Naturen fast schon vor dem Lesen warnen möchte. Die 1993 in Australien geborene Schriftstellerin hat in Oxford Englische Literatur und in Sydney Kunst mit Schwerpunkt Malerei studiert. Der vorliegende Roman ist nicht nur eine äußerst sprachgewaltige, poetische Hymne auf das Meer, sondern auch ein krasser Beitrag zur Me-Too-Bewegung.
Alles beginnt mit einer scheinbaren Entführung auf einem Boot, als Olivia, die Protagonistin des Buches völlig verkatert auf einem Segelboot unter Deck aufwacht. Ihr Entführer entpuppt sich aber als gutmütiger alter Seebär. Mac und seine Frau Maggie, eine blinde Künstlerin werden durch diesen Zufall zu besten Freunden und so etwas wie Ersatz-Eltern für die gerade 21jährige Oli.
Ihre eigenen Eltern leben irgendwo an unterschiedlichsten Ecken dieser Erde und haben recht wenig mit ihr zu tun, außer ständiger, übersteigerter Erwartungen an die Tochter. Auch ihr damaliger dominanter Freund Adam schlägt in die gleiche Kerbe. Anstatt eines Kunststudiums absolviert Oli den Master-Kurs als Wirtschaftswissenschaftlerin.
Als ihr Großvater, bei dem sie gelebt hat, stirbt, erscheinen die Eltern zur Beerdigung wie zu einer Pflichtveranstaltung. Das Tragen korrekter Kleidung erscheint wichtiger als die Trauer. Als ihre Mutter dennoch in Tränen ausbricht, kommentiert Oli das wie folgt: „Die Farbe des Geheuls ist ein unbehagliches Orangerot wie nasses Herbstlaub, matschig und halb verrottet“. Überhaupt spielen sich viele Emotionen und Gefühle in Farben ab. Wie ihre Seelenverwandte, die Freundin Maggie, die blinde alte Künstlerin ist sie selbst Synästhetin und sieht Farben, wenn sie Geräusche, Wörter oder Zahlen hört.
Durch Maggie und Mac, die sie immer häufiger auf ihrem Segelboot mitnehmen, entdeckt Oli ihre Liebe und Faszination für das Meer. Sie zeigen ihr das Korallenriff und die Magie des Wassers beim Tauchen und Schwimmen. Sie entdeckt kalbende Gletscher, das grüne Leuchten am Horizont und ihre Liebe zur Natur. In großartigen Bildern schildert die Autorin dieses Aufkeimen eines neuen Lebens. So endet der erste Teil des Buches voller Poesie und Liebe, wie Walgesänge als Strudel aus Violett und Preußischblau.
Nach vier Jahren der Tätigkeit auf See begegnet sie auf den Salomon-Inseln einer Crew aus fünf jungen Männern ihres Alters, die ihr einen Job bei der Überführung einer Segeljacht nach Neuseeland anbieten. Von Anfang an wird sie nicht als gleichwertiges Crew-Mitglied anerkannt. Die jungen Männer zeigen keinerlei Respekt und Achtung vor Olivia. Anzüglichkeiten führen zu Demütigungen und Verletzungen, die in einer brutalen Vergewaltigung unter Deck enden. Die Macht und Übermacht der Jungs zwingt sie in eine Ohnmacht, aus der sie sich nicht befreien kann.
Nun erfährt Oli, dass der uralte Ozean in all seiner Pracht auch dunklere Farben, Grauen und nackte Gewalt bereithält. Alles verschwindet in einem tiefen, satten Rot aus Zynismus und Bösartigkeit. Für Oli geht es nur noch ums Überleben und Ankommen in Neuseeland. Völlig traumatisiert geht sie sprachlos von Bord und betritt jahrelang nie wieder ein Boot.
 Wieder vier Jahre später lebt Olivia in London und arbeitet als aufstrebende Kuratorin in einer Galerie. Langsam ist sie zurück ins Leben gekehrt, obwohl sie nie über ihr Trauma sprechen konnte. Selbst ihr neuer Freund, ein freundlicher, emphatischer Mann weiß nichts von ihrer grausamen Geschichte. Gemeinsam mit anderen starken Frauen gewinnt sie ganz langsam ihre Lebensfreunde und ihre Liebe zum Meer zurück. Alles kristallisiert sich in einer gemeinsamen Kunstreise in die Antarktis, die die Autorin im eigenen Leben selbst bereist hat.
Wieder vier Jahre später lebt Olivia in London und arbeitet als aufstrebende Kuratorin in einer Galerie. Langsam ist sie zurück ins Leben gekehrt, obwohl sie nie über ihr Trauma sprechen konnte. Selbst ihr neuer Freund, ein freundlicher, emphatischer Mann weiß nichts von ihrer grausamen Geschichte. Gemeinsam mit anderen starken Frauen gewinnt sie ganz langsam ihre Lebensfreunde und ihre Liebe zum Meer zurück. Alles kristallisiert sich in einer gemeinsamen Kunstreise in die Antarktis, die die Autorin im eigenen Leben selbst bereist hat.
Mit der Reise verändern sich die Stimmungen und die Farben, der Prozess der Heilung lässt die Farben wieder glitzern und explodieren. Das Meer symbolisiert durch seine artenreichen, glasklaren, türkisblauen Wasser die Reinigung des Körpers und der Seele. Der Roman lebt von seinen überbordenden Emotionen, die sowohl grauenvoll und völlig tabulos geschildert werden, aber auch von Glücksmomenten größter Poesie und Liebe. Dem Zynismus des Skippers, der Olivia sprichwörtlich den Atem nimmt, als er höhnt: „Warum hast du nicht geschrien, wenn du es nicht wolltest“, setzt die Autorin die Solidarität und Lebensfreude der Frauen entgegen, mit deren Hilfe sie so langsam das Trauma ihres Lebens in den Weiten des Meeres entlassen kann. Insgesamt bleibt es offen, aber man spürt den Frieden, den Oli ganz zart beginnt, mit sich selbst zu schließen.
Sophie Hardcastle: Unter Deck, Verlag Kein & Aber, Zürich, Mai 2021, 320 Seiten, Amazon.
Die Bücher sind in den inhabergeführten Buchhandlungen Belling, Prosa, Buchfink, Arno Adler, Langenkamp, maKULaTUR und Buchstabe erhältlich.
Titelfoto: Juli Zeh, Foto: (c) Heike Huslage-Koch/ Wikimedia, CC BY-SA 4.0