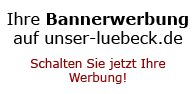"Good night everybody. We had fun. What about you?", verabschiedet sich John Cale nach 90 Minuten wahrhaftiger Live-Musik beim aufgestanden applaudierenden Publikum in der Halle K6 auf Kampnagel.
Ein kurzes Lächeln, eine Geste, dann, den kurzen Schritt seines Alters in silbernen Glitzerschuhen, verlässt er im dunklen Tuxedo-Tailcoat die Bühne. Geht seiner Wege. Schlicht, fast dienstfertig, nichts, das einer ordentlichen Lichtgestalt nahekäme, die manche in ihm sehen möchten.
Er ist Musiker, einer der wenigen als solcher, den man einzigartig nennen kann. Niemand außer ihm klang je wie er. Cale litt und leidet zeitlebens an der abgefuckten menschlichen Spezies und sich selbst als als einer davon, hatte lange eine ethisch peinigende Faszination für Waffen und brachte Perspektiven und Erkenntnisse radikal sauber zum Ausdruck: "When you've begun to think like a gun / the rest of the year has already gone." Und trotz alledem und alledem leidet er unter der Vergeblichkeit des Lebens. John Cale hat das Zeug zur lebenden Legende. Und kein Interesse daran.
Aus dem Ärmel
Cale ist 80, seit 60 Jahren dabei, radikaler Vordenker von Anfang an, mit 18 Studioalben plus Kollaborationen in einem stilistischen Spektrum von experimenteller Kompositionsarbeit über noisige, schlagstarke Rockmusik bis zu grandiosem, bürgerlich anmutendem Songwriter-Pop mit doppelten Böden.

Mit Wissen über Dynamik und musikalische Funktionalität plus Intuition baut Cale aus klaren Strukturen Raum für komplexe Inhalte, entwickelt schnell eingängige, organische und – auch das noch! - abriebfreie Songs jenseits des Banalen, die klingen wie aus dem Ärmel gerutscht. Bewundert und gecovert von namhaften Kolleg*nnen wie Rufus Wainwright, Yo La Tengo, Billy Bragg, Agnes Obel, Nick Cave, PJ Harvey etc. pp., ist Cale auch mittelbar eine der maßgeblichen Einflüsse in der gesamten Rock- und Songmusik, von Alternative Rock bis in den gehobenen Mainstream.
Als Produzent hat er bis heute 75 Alben betreut, darunter Nicos „The Marble Index“ (1968), die innovativen Debüts der Stooges (1969), Modern Lovers (1976) und Patti Smith („Horses“, 1975), die Happy Mondays, Alejandro Escovedo, The Jesus Lizard, Element Of Crime. Cale spielte als Studiomusiker für u. a. Nick Drake, schrieb Filmmusik (u.a. „Basquiat“, „American Psycho“) und ist hauptverantwortlich für die beispiellose Bekanntwerdung des Leonard-Cohen-Songs „Hallelujah“. (Die abendfüllende Filmdoku „Hallelujah – Leonard Cohen, A Journey, A Song“ erzählt die Geschichte.)
Aufriss
"Jumbo In Tha Modern World Circus" (2007) öffnet die interessante Runde durch das umfangreiche Cale-Oeuvre mit Schwerpunkt "Mercy", seinem erstem neuen Album seit 10 Jahren, dem insgesamt achtzehnten im Schaffen des ruhelosen 80-Jährigen. Ein ansatzweise kühles, klangflächiges Songalbum, mit hemmungsloser Besonnenheit und vollen Händen modern produziert; live, mit ambienten Silben und atmosphärischen Andeutungen - u.a. ein großartig gesetztes Opernsopran-Sample - anstelle der satten Studiotextur, zeichnen sich die grundlegenden Songs stärker ab. Cale-Songs, emotional unterschiedlich disponiert, die der Menschheit eine kurze, unkomfortable Restzukunft mit wenig Aussicht auf Besserung ansagen, und dennoch und gerade dringend von Hoffnung und Gemeinschaft sprechen: "Help me to help you to figure things out."

Und dann ist es weg, alles irgendwie Tapsige, und das Alter obsolet, als Cale hinter den Keyboards zu singen beginnt. Die Stimme ist voll da, der gerade, maskuline Bariton abseits von Machismo, Seichtigkeit u. a. Komfortzonen, Markenzeichen, und etwas irre in Narrativen wie „Pablo Picasso“ („... was never called an asshole …“) und „Helen Of Troy“ aus den Mittsiebzigern. Rock. Simpel, behämmert, zähneknirschend abstrakt; Cale wechselt zur Gitarre, der Sound fett und dreckig wie ein Klumpen Altöl. Tolle Sache.
Dass andere Cale-Klassiker aus jenen Tagen nicht dabei sind – „Fear Is A Man's Best Friend“ oder die kalt verzweifelte Version von Elvis' „Heartbreak Hotel“, steinharte, kompromisslos durchgezogene Rockinstallationen -, ist wesentlich für den tendenziell kontemplativen, homogenen Charakter des Konzerts, Songs, die hinterfragen, mal innehalten, die neuen Stücke gleichauf ins Verhältnis setzen. Ohnehin unwahrscheinlich ist,, dass Cale als Sänger noch die physische Kraft für den notwendigen kaputten, paranoiden, gewalttätigen Ausdruck solcher Nummern besitzt, mit der er vor 40 Jahren, solo am Klavier, das Publikum packte und seelisch regelrecht aufriss, mit abrupten, vollkommen entgrenzten Schreianfällen („Waiting!!!“) ein neues Ausmaß öffentlicher Selbstentäußerung konstatierte, ein paar Leute flohen verängstigt und weinend aus der Hamburger Fabrik. '84 in Essen, mit Band in der Rockpalast-Nacht, Cale als psychisch finaler Gesamteindruck. Stoisch, wächsern, hermetische Sonnenbrille, hielt er kaum ein Stück durch, explodierte mit wütenden Schlägen in die Tastatur, zerpflückte in Nahaufnahme auf allen Vieren den Bodenbelag. Die Halle war bereits vor Veranstaltungsende weitgehend leer. Inszeniert? Die Rockpalast-Geschichtsschreibung hält sich unscharf.
Samt und besonders
John Cale, *1942, Bergmannssohn aus Wales/GB, klassisch ausgebildeter Pianist und Bratschist (Leonard-Bernstein-Stipendium), spielte u. a. neue Musik bei John Cage und im Ensemble des Minimal-Music-Pioniers La Monte Young, The Theatre of Eternal Music, zu dessen Spezialitäten das Erzeugen und Halten von Drones über Stunden gehörte. 1965, nun auch Bassgitarrist, gründete Cale mit Lou Reed (voc, git), Sterling Morrison (git), Maureen Tucker (dr) sowie dem Kölner Top-Mannequin Nico (voc) die Artrock-Avantgarde-Combo The Velvet Underground; Andy Warhol engagierte VU 1966-67 für sein Multimedia-Happening „Exploding Plastic Inevitable“.

Zwei Alben später – anti-Hippie, anti-Establishment, unberechenbar zwischen Noise, Proto-Postpunk (!) und melancholischem Pop mit Texten über SM-Sex, Heroin, Vietnam u. a. Tabus der United States of Wohnzimmer – wurde Cale durch Reed aus der Band gedrängt. Nach noch zwei ausgesprochen coolen Rocksong-Alben mit fragilen Songperlen („Pale Blue Eyes“!) ging Lou ebenfalls eigene Wege, die Band war Geschichte. Zumindest schien es so.
Als Lou Reed '72 mit „Walk On The Wild Side“ in die internationalen Charts geriet, erschien, so ein Zufall, auch das hämmernde „Waiting For The Man“ vom ersten VU-Album als Single, lief im (europäischen) Mainstream-Radio. Mit Beginn des US-Punk ein paar Jahre später und Leuten wie Iggy Pop, David Bowie und Bauhaus, die sie als wichtigen Einfluss bezeichneten, wurden VU neu entdeckt, post-mortem zu einer der unbestreitbar einflussreichsten Rockbands der Geschichte. Die Alben erschienen neu, und nachdem Cale und Reed sich schon '90 für „Songs For Drella“, Hommage-Album für den verstorbenen Andy Warhol, zusammenraufen konnten, ging VU '93 in Originalbesetzung (ohne die '88 verstorbene Nico) auf Tour, sahen sich gefeiert von vielen jüngeren Leuten, Indie- und Alternative-Kids, ahnungslos mitunter und überrascht, dass die Musiker derselben Generation angehörten wie die eigenen Eltern. Und Großeltern.
2023
Gut 700 Zuschauer*nnen sind im Kampnagel, ein 3-Generationen-Publikum inzwischen, zum Teil alt genug, dass Cales Musik sie über Dekaden begleitet haben könnte, geschätzt, gebraucht, Teil des Lebens wurde. Anekdoten in den Sitzreihen, hellgraue Frauenfrisuren und lichte Altmännerköpfe rocken saturiert, schließen die Augen weg; junge Leute mit Scheitel, Sneakern, Rock und Bluse und Textkenntnissen applaudieren, als die Musiker sich auf der Bühne positionieren: Dustin Boyer (git, samples), Bassist Joey Maramba, Alex Thomas (dr, synth), exzellente professionals, schon seit Längerem in Cales Band, der als Leader und Mitglied fungiert. Es federt, hat Druck und Raum, strahlt angenehm pragmatisches Selbstvertrauen ab.

Die zärtliche Kraft von "Moonstruck (Nico's Song"), in dem Cale sich an die Freundin und VU-Sängerin mit der ungeschulten Altstimme erinnert, erwischt einen auf der Stelle, ohne als Klischee aus dem Schrank zu fallen. Ein langer, tiefer Drone, massiv und weich mit gestrichener Bassgitarre, vor nassen, chlorophyllgrünen Mikroskopaufnahmen auf der Leinwand, mündet mit einem ruhigen Handumdrehen bruchlos in eine transparent schimmernde Version von „Hanky Panky Nohow“, von Cales '73er Album „Paris 1919“. Wie in dessen Titelsong über die bigotte Pariser Neuverhackstückungskonferenz nach dem 1. Weltkrieg, und '82 Cales radikale Umdeutung von Beethovens Europa-Hymne „Ode an die Freude“ in den brüchigen Abgesang „Damn Life“ („Music For A New Society“), so ist die Alte Welt auf dem neuen Album wieder Thema, spricht Cale eine bittere gegenwärtige Wahrheit nüchtern aus: „The Grandeur that was Europe is sinking in the mud.“ Kein Blatt vor dem Mund, die ruhige Version. Weh tut es dennoch. Gut so. Ein Konzert, das, wie sich herausstellte, nachhallt. Ich bin froh, dass ich da war.
Die furchtgeliebte Feedback-Bratsche blieb übrigens im Koffer. „Niemand“, hat Cale mal in einem Interview gesagt, „will wirklich Bratsche spielen.“ Ach, so.
Fotos: (c) Holger Kistenmacher