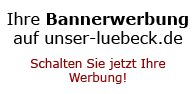Mit den gotischen Altären und mittelalterlichen Drucken und Manuskripten aus dem reichen Bestand unserer lieben Vaterstadt setzt sich die europäisch-kanadische Künstlerin Alice Teichert in der aktuellen Ausstellung des Museumsquartiers St. Annen auseinander.
Nicht viele Häuser haben ein Konzept wie das Museumsquartier St. Annen: eine Verbindung von ganz Altem und sehr Neuem, schon ablesbar an dem Gegensatz zwischen den spätgotischen Räumen eines mittelalterlichen Klosters und dem nackten Beton der Kunsthalle. Unter diesen Umständen liegt es nahe, sich immer wieder an Ausstellungen zu versuchen, die beide Gebiete miteinander verknüpfen. Vor einem Jahr wurden – zu seinem Abschied von dem langjährigen Direktor Thorsten Rodiek kuratiert – die Arbeiten des Amerikaners Ken Aptekar aus- und vorgestellt, eines Konzeptkünstlers, zu dessen Markenzeichen seine ganz spezielle Beschäftigung mit der Geschichte der Kunst geworden ist: Er malt Bilder neu. Als er das Museumsquartier St. Annen besuchte, fiel ihm in Lübeck die Nähe von Kloster und Synagoge ins Auge, und so entstand eine Ausstellung, die nicht allein mittelalterliche Kunst, sondern vor allem das Schicksal Lübecker Juden reflektierte.
Das Konzept der aktuellen Ausstellung ist ganz ähnlich. Alice Teichert, eine in Kanada lebende Künstlerin mit europäischen Wurzeln, ließ sich von den gotischen Altären und mittelalterlichen Drucken aus dem St. Annen-Museum zu eigenen Arbeiten inspirieren. Kuratiert wurde diese Ausstellung von Rodieks Nachfolgerin Dagmar Täube, einer mediävistisch ausgebildeten Kunsthistorikerin, die eben gerade eine Monographie über Teichert veröffentlicht hat. Kompetenter hätte die Betreuung eines solchen Projekts also unmöglich sein können.
 Künstlerin Alice Teichert, Foto: Stefan Diebitz
Künstlerin Alice Teichert, Foto: Stefan Diebitz
Gemeinsam ist beiden Herangehensweisen, dem Aptekars wie dem Teicherts, eine große Naivität. Aptekar legte Wert darauf, dass man nicht viel wissen muss, um auch einem exotischen oder sonst schwer verständlichen Kunstwerk begegnen zu können, denn schließlich gebe es ja auch die Ebene der einfachen Menschlichkeit. Deshalb sprach er angesichts der jüdischen Leiden von „sadness“ oder „tristesse“ und machte deutlich, dass es ihm ganz wesentlich auf den Ausdruck von Stimmung („mood“) ankomme. Und um diese wahrzunehmen, müsse man sensibel und offen sein, aber eben nicht viel wissen.
In einer Broschüre für die Ausstellung schreibt Dagmar Täube über die Arbeit Teicherts, es gehe „nicht darum, ihre Bilder zu verstehen, sondern darum, sie zu fühlen“. Ganz falsch kann ich das so wenig finden wie die Äußerungen Aptekars, aber man muss doch zu bedenken geben, dass Kunst, wenn sie auf ein ästhetisches Erlebnis reduziert wird, für jeden Betrachter notwendig ein anderes sein muss, also jeder notwendig mit seinen Erlebnissen für sich bleibt. Es ist ein Zugang, aber es sollte keinesfalls der einzige Zugang bleiben – insbesondere dann nicht, wenn man sich der Kunst einer sehr fernen Zeit nähert. Will man sich wirklich auf seine Gefühle verlassen, wenn man sich ein Triptychon des 15. Jahrhunderts anschaut? Dann wird man nicht sehr viel verstehen.
Teicherts Bilder sind abstrakt. Zwar schreibt Täube, dass „ihre Bilder weder gegenständlich noch abstrakt“ sind, sondern „irgendwo dazwischen schweben“, aber ich finde sie einfach nur abstrakt – schließlich bilden sie weder Lebewesen noch Gegenstände ab. Ich verstehe nicht ganz, warum sie „dazwischen schweben“ sollen; für mich sind es Bilder in der Tradition des abstrakten Expressionismus, und zwar gut gemachte: Viele sind ästhetisch sehr reizvoll. Aptekars Projekt war mehr gut gemeint als gut gemacht, aber die Arbeiten Teicherts sind qualitativ hochwertig. Alice Teichert - On the Way, Foto: Stefan DiebitzEs sind ihre leuchtenden Farben, für die Teichert bekannt ist. Dank der Sorgfalt ihrer Arbeitsweise besitzen ihre Arbeiten trotz ihrer fehlenden Gegenständlichkeit eine gewisse räumliche und damit auch poetische oder künstlerische Tiefe. Es sind bis zu dreißig, teils leicht durchscheinende Bildschichten, mit denen die Künstlerin ihre Bilder bemalt; so sind diese leuchtstark und farbenintensiv und scheinen einen Raum anzudeuten. Hatte bereits Caspar David Friedrich seinem Freund und Kollegen Carl Gustav Carus dazu geraten, Mondlichtbilder zum Rand hin dunkler werden zu lassen, so folgt auch Teichert auf mehreren Bildern diesem Rezept, auch wenn sich bei ihr kein Mond findet: Das ist ein weiteres Moment, das für die Illusion einer gewissen Räumlichkeit sorgt. Auch ist es zu empfehlen, ohne den Blick abzuwenden, langsam an den Bildern vorbeizugehen – sie verändern sich, wenn man eine andere Perspektive einnimmt, und das wird mit ihrer reliefartigen Struktur zu tun haben, vielleicht aber auch mit den vielen, teils transparenten Farbschichten.
Alice Teichert - On the Way, Foto: Stefan DiebitzEs sind ihre leuchtenden Farben, für die Teichert bekannt ist. Dank der Sorgfalt ihrer Arbeitsweise besitzen ihre Arbeiten trotz ihrer fehlenden Gegenständlichkeit eine gewisse räumliche und damit auch poetische oder künstlerische Tiefe. Es sind bis zu dreißig, teils leicht durchscheinende Bildschichten, mit denen die Künstlerin ihre Bilder bemalt; so sind diese leuchtstark und farbenintensiv und scheinen einen Raum anzudeuten. Hatte bereits Caspar David Friedrich seinem Freund und Kollegen Carl Gustav Carus dazu geraten, Mondlichtbilder zum Rand hin dunkler werden zu lassen, so folgt auch Teichert auf mehreren Bildern diesem Rezept, auch wenn sich bei ihr kein Mond findet: Das ist ein weiteres Moment, das für die Illusion einer gewissen Räumlichkeit sorgt. Auch ist es zu empfehlen, ohne den Blick abzuwenden, langsam an den Bildern vorbeizugehen – sie verändern sich, wenn man eine andere Perspektive einnimmt, und das wird mit ihrer reliefartigen Struktur zu tun haben, vielleicht aber auch mit den vielen, teils transparenten Farbschichten.
Der Gegensatz zwischen den Arbeiten der 1959 geborenen Alice Teichert und den mittelalterlichen Kunstwerken aus dem St. Annen-Museum könnte kaum größer sein: Ist den alten Werken eine feste Bedeutung eingeschrieben, ist ihre geistige Mitte die Theologie, so kennen moderne Arbeiten keinen derartigen Bedeutungszusammenhang, und sind damit so autonom, wie die Kunst des Mittelalters heteronom gewesen ist. Jedem Künstler des Mittelalters, der seine eigenen Gefühle hätte abbilden wollen, hätten seine Auftraggeber etwas gehustet; natürlich war er an zahllose Vorgaben gebunden. Er durfte wohl eine persönliche Note hereinbringen, hatte sich aber mit einem engen Korsett abzufinden.
 Alice Teichert: By Air, Foto: Lübecker Museen
Alice Teichert: By Air, Foto: Lübecker Museen
Ganz, ganz anders ein Künstler unserer Tage. Ist er nur einigermaßen renommiert, muss sich der Auftraggeber etwas husten lassen, falls er mit Vorgaben kommen wollte. Und nun gar ein abstraktes Bild … Man kann es unmöglich so interpretieren, wie ein Tafelbild des Mittelalters durchbuchstabiert werden kann und muss, und lässt den Betrachter gewissermaßen aus Grundsatz mit seinen Deutungen und Zumutungen allein. Für Teichert wie wohl für viele andere der heutigen Künstler ist eine „offene Bedeutung“ das Ziel ihrer Arbeit, deren gelegentlich extreme Subjektivität eine nicht hinterfragbare Selbstverständlichkeit. Und Sprachlosigkeit ihnen gegenüber ist eine fast notwendige Folge.
Wie vieldeutig und offen die Arbeiten Teicherts sind, kann man an ihrer Titelgebung sehen. Die Künstlerin nämlich führt vorsorglich Listen mit möglichen Titeln, und wenn sie ein Bild fertig gemalt hat, schaut sie in ihnen nach, ob sich ein passender Titel darunter befindet. Ein solcher Titel ist dann wie ein Name, der einem Kind von seinen Eltern gegeben wird: So wenig ein Name etwas über den Charakter eines Menschen verrät, so wenig sagt hier der Titel etwas über den Gegenstand, die Thematik oder gar den Sinn einer Arbeit. Teicherts Bilder verweigern wirklich jede Antwort auf jede überhaupt nur denkbare Frage, und unter diesen Umständen muss es mehr als kühn sein, eine derart weite Kluft wie die zum Mittelalter überbrücken zu wollen. Kühn heißt vielleicht nicht hoffnungslos, aber man wird schon die Frage stellen dürfen, ob sich die Künstlerin im vollen Ernst auf den Bedeutungshorizont mittelalterlicher Kunst eingelassen hat; oder man darf fragen, ob es im Rahmen abstrakter Kunst möglich ist, die Anregungen des Mittelalters aufzunehmen.
 Alice Teichert - In)Formation, Foto: Lübecker Museen
Alice Teichert - In)Formation, Foto: Lübecker Museen
Wie Aptekar sucht Teichert nicht nach einem gelehrten und letzten Endes spirituellen, sondern nach einem „intuitiven und sinnlichen“ Zugang; sie hat die Bilder und Altäre von St. Annen studiert und sich ganz naiv ebenso von den Farben anregen lassen wie von der vielfach anzutreffenden Thematisierung der Schrift. Und mit Schrift ist jetzt nicht die „Bibel“ gemeint, sondern das Buch überhaupt, auch wenn sich im Allgemeinen die „Heilige Schrift“ in den Händen der Figuren befindet. Seit 2008 arbeitet Teichert an Bildern, deren Gliederung den Aufbau einer doppelten Buchseite nachahmt. In den Worten Täubes: „Sie bestehen, inspiriert durch mittelalterliche Stundenbücher, jeweils aus einer linken Bildhälfte, die eine Farbimpression zeigt, und einer rechten Bildhälfte, die vor allem aus Scribbles, Linien und abstrakten Schriftzeichen besteht.“
Teichert hat sich also mittelalterliche Handschriften angeschaut und die formale Aufteilung der Seiten übernommen. Ist bei vielen der Inkunabeln die eine Seite illustriert, die andere beschriftet, so findet sich diese Aufteilung auch bei Teicherts Bildern. Aber diese bieten nicht Text, sondern nur so etwas Ähnliches wie Text: Sinnlose, sinnfreie Zeichen, die ein Schriftbild imitieren und einen gewissen Sinn anzudeuten scheinen – einen Sinn, den es aber nicht gibt. Jedenfalls keinen Sinn, den man aussprechen oder niederschreiben könnte.
Und dominieren bei den Inkunabeln die Farben rot, blau und grün, so finden sich diese Farben ebenfalls in Teicherts Arbeiten, ohne dass sie heute noch eine Bedeutung besitzen würden. Jetzt sind es wirklich nur die Farben, die beide Seiten verbinden, mehr Gemeinsames gibt es nicht. Es ist, den vielen Zeichen zum Trotz, eine sprachlose Kunst auf dem Weg in die Mystik.
 Alice Teichert, Ancient Dreams, Foto: Stefan Diebitz
Alice Teichert, Ancient Dreams, Foto: Stefan Diebitz
Die Mystik gehört zu den untergründigen Strömungen des 20. Jahrhunderts; in meinem gegen die analytische Philosophie polemisierenden Buch „Glanz und Elend der Philosophie“ bin ich von Wittgensteins Affinität zur Mystik ausgegangen, konnte aber auch auf so unterschiedliche Autoren wie Robert Musil, Martin Heidegger oder Ernst Tugendhat verweisen. Und von dem großen Spanier José Ortega y Gasset gibt es einen prachtvollen, mit einer poetischen Sprache prunkenden Essay gegen die Mystik (unter dem Titel „Verliebtheit, Ekstase und Hypnose“), in der die mit Verliebtheit einhergehende Verblödung mit der Mystik in Verbindung gesetzt wird, in der uns Sprache und Verstand ausgehen: Die Lippen „sind halbgeöffnet zu einem universalen Lächeln, das unaufhörlich von den Mundwinkeln tropft. Es ist die Geste des Toren – und des Betörten.“ Das, resümiert Ortega, „ist der Zustand der Gnade, der dem Verliebten mit dem Mystiker gemein ist“. Worauf es dem Philosophen ankommt, ist die Sprachlosigkeit, was er vermisst, ist kühle, vernunftbetonte Distanz und Vermittlung.
Im St. Annen-Museum konfrontiert uns Teichert mit einer Illusion von Schrift und Botschaft, und auch wenn sie sich von der mittelalterlichen Kunst und besonders von der Vielfalt der mittelalterlichen Schriften inspiriert fühlt und an diese anzuknüpfen bemüht ist, so handelt es sich hier zweifellos um einen antagonistischen Gegensatz. Gibt uns die mittelalterliche Kunst eine Antwort, die wir immer noch verstehen, auch wenn wir mit ihr nichts mehr anzufangen wissen, so sind die Schriftzeichen Teicherts die Parodie einer Botschaft und eigentlich nur eine Art rhythmisiertes Schweigen wie der „Gesang der Fische in der Nacht“. Täube schreibt: „Es geht nicht um das Erfassen einer konkreten Aussage, sondern vielmehr um das Unaussprechliche, das nicht Greifbare.“ Eben: um Mystik.
Der größte Teil der Ausstellung findet sich in den Räumen der Kunsthalle präsentiert, denn die großen Formate und bunten Farben der Moderne vertragen sich gut mit einer rechtwinkligen, leicht ins Parkhaus-artige spielenden Betonsichtigkeit. Mit den wunderbaren Räumen des alten Klosters dagegen würden sie sich beißen. Nur ein kleiner Teil – stark vergrößerte Fotografien von Details der Altäre – steht im Remter zwischen den prachtvollen Altären (siehe Titelfoto).
 Blick in die Ausstellung, Foto: Oliver König
Blick in die Ausstellung, Foto: Oliver König
Besonders angepriesen werden müssen die kostbaren Handschriften, die in dieser Ausstellung neben den Arbeiten von Teichert gezeigt werden. Wann hat man schon die Gelegenheit, ein Exemplar des „Sachsenspiegel“, ein wunderbares Stundenbuch, illustriert mit Blattgold und Lapislazuli, oder einen mittelalterlichen Psalter und andere Musiknotationen zu bewundern?
Dazu kommen Schriften und Texte ganz anderer Art: Protokolle wie das Eidbuch des Rates der Stadt oder das Statutenbuch von 1429 einer elitären Gemeinschaft Lübecker Bürger, der „Zirkel-Gesellschaft“. Man glaubt gar nicht, wie viele wirkliche Kostbarkeiten in Archiv und Stadtbibliothek vorhanden sind – und das in einer Stadt, die nicht ganz zu Unrecht (und mir sowieso) als die Stadt der Pfeffersäcke gilt.
Katalog: Dagmar Täube: In) Formation: On the Philosophy and Art of Alice Teichert. Hirmer 2017
Alice Teichert „Zwischen den Zeilen“
Ausstellung bis zum 15. Oktober 2017
Museumsquartier St. Annen
Öffnungszeiten: Di-So 10-17 Uhr
Fotos: Oliver König