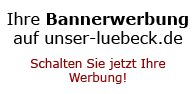Was zunächst im März unter „Bob Dylan – No Direction Home“ als Sonderveranstaltung gegeben wurde, kam so gut an, dass man sich „wegen großer Nachfrage“ entschied, den Abend zu Ehren des jüngsten Nobelpreisträgers noch mehrmals zu geben. Als Quasi-Premiere dieser neuen Reihe empfahl sich der 24. Mai, Dylans Geburtstag. 76 ist er geworden. Geboren wurde er in Duluth, Minnesota, bekanntlich als Robert Allen Zimmerman.
Der Abend mit dem Untertitel „Ensemble in Concert“ zeigte nahezu das gesamte Schauspielensemble in den Kammerspielen von seiner musikalischen Seite, zeigte den Spaß am Singen und an der Rolle, wie ein Rockstar aufzutreten. Das kam gut über die Rampe. Zur Ehrung des amerikanischen Rockbarden und Dichters wollte man beitragen, wie vielerorts, in Kiel und anderswo auch, wobei Lübeck den Vorteil hat, einen wirklich vor Ort Geborenen preisen zu können, nämlich Thomas Mann, und noch zwei, die eben diese Stadt als ihre Heimat betrachten, nämlich Willy Brandt und Günter Grass. Dylan, Jüngster im Nobelclub, war also in bester Gesellschaft. Bei seiner Geburtstagsfeier an der Beckergrube gab es dann für ihn sinnigerweise zum Schluss einen weiß bepuderten Napfkuchen mit einer dicken Kerze. Elektrisch war sie, eine echte hätte etwas entzünden können. Irgendwie musste auch der Erfinder dieser Schau solche Sicherheitsschranken im Kopf gehabt haben. Denn der setzte ganz auf Kurzweil für das Publikum, nicht auf Erkenntnis.

Man erinnert sich gut, welchen Wirrwarr es um die Preisübergabe gab, – nein, man muss wohl eher sagen, welchen ER machte. Verkürzt war das: kein Kommentar – nein – vielleicht – nicht ich komme nach Stockholm – oder später und inkognito. Wie es dann geschah. Offiziell wurde der Nobelpreis für Literatur ihm 2016 als erstem Musiker für „… seine poetischen Neuschöpfungen in der großen amerikanischen Songtradition“ zuerkannt, heißt es in Pressemitteilung der Akademie. Die Reaktionen haben seltsam changierende Gesichter. Zitiert seien drei, die der „Spiegel“ in einem Artikel im Oktober letzten Jahres auflistet. In „Nobelpreis? Nicht der Rede wert“ kommentiert der Schotte Irvine Welsh („Trainspotting“), Fan von Dylan, „die Entscheidung des Preiskomitees sei unausgereifte Nostalgie alter Hippies“. Norman Mailer soll gesagt haben: „Wenn Dylan ein Dichter ist, bin ich ein Basketball-Spieler." Contra gibt Salman Rushdie, der twitterte: „Dylan ist der brillante Erbe einer Barden-Tradition. Großartige Wahl."
 Von irgendwelcher Auseinandersetzung mit ihm war an diesem Abend keine Spur. In Pit Holzwarths Inszenierung war er auf etliche verteilt. Neun waren es, vier Frauen: Rachel Behringer, Nadine Boske, Astrid Färber und Susanne Höhne, und vier Männer: Matthias Hermann, Henning Sembritzki, Timo Tank, Jochen Weichenthal und Lars Wellings. Wer nun der Echte war? Jeder, ein bisschen. Das aber machte die Darstellung wenig übersichtlich, auch wenn Susanne Höhne sich eigens eine Perücke überstülpen musste, obwohl längst klar war, dass auch die Frauen eine Inkarnation des Verehrten boten. Dafür war für jeden weniger Text und Melodie zu lernen. Jeder sang auch solo oder im Duett oder mit Backgroundsänger/innen oder im Ensemble, jeder sprach ein paar Texte moderierenden oder biografischen Inhalts. Der beschränkte sich auf knappe Hinweise und auf einen Zeitraum von circa fünf bis sechs Jahren in den 1960ern. Das ist die Zeit, in der er, der Barde und Dichter, vom Folksänger zum Rockmusiker mutierte, in der er „Don’t Think Twice, It’s All Right“ sang und sich „on the dark side of the road“ sah, – und das ist die Zeit sozialer und politischer Auseinandersetzung in Amerika und anderswo. Es ist auch die Zeit, in der sich Martin Scorseses dokumentarische Filmretrospektive aufhält, die 2005 Dylans Schaffen und seine Umgebung porträtierte, an die sich, schon wegen des gleichen Titels, die Lübecker Darstellung offensichtlich hält.
Von irgendwelcher Auseinandersetzung mit ihm war an diesem Abend keine Spur. In Pit Holzwarths Inszenierung war er auf etliche verteilt. Neun waren es, vier Frauen: Rachel Behringer, Nadine Boske, Astrid Färber und Susanne Höhne, und vier Männer: Matthias Hermann, Henning Sembritzki, Timo Tank, Jochen Weichenthal und Lars Wellings. Wer nun der Echte war? Jeder, ein bisschen. Das aber machte die Darstellung wenig übersichtlich, auch wenn Susanne Höhne sich eigens eine Perücke überstülpen musste, obwohl längst klar war, dass auch die Frauen eine Inkarnation des Verehrten boten. Dafür war für jeden weniger Text und Melodie zu lernen. Jeder sang auch solo oder im Duett oder mit Backgroundsänger/innen oder im Ensemble, jeder sprach ein paar Texte moderierenden oder biografischen Inhalts. Der beschränkte sich auf knappe Hinweise und auf einen Zeitraum von circa fünf bis sechs Jahren in den 1960ern. Das ist die Zeit, in der er, der Barde und Dichter, vom Folksänger zum Rockmusiker mutierte, in der er „Don’t Think Twice, It’s All Right“ sang und sich „on the dark side of the road“ sah, – und das ist die Zeit sozialer und politischer Auseinandersetzung in Amerika und anderswo. Es ist auch die Zeit, in der sich Martin Scorseses dokumentarische Filmretrospektive aufhält, die 2005 Dylans Schaffen und seine Umgebung porträtierte, an die sich, schon wegen des gleichen Titels, die Lübecker Darstellung offensichtlich hält.
Joan Baez kam vor, nicht Susan Elizabeth „Suze“ Rotolo, die andere Muse dieser Zeit. Oder hat der Rezensent das überhört? Die Tontechnik hatte nicht ihren besten Tag. Dass für alle Neune nur sieben Mikrofone vorhanden waren, war nicht das Problem, Problem war die Mischung, die die Sprache, auch die Songtexte zu starkem, aber süffigem Brei werden ließen. Gesungen wurde in den eineinhalb Stunden viel, sehr viel, zumeist gut und mitreißend. Die Zuschauer fühlten sich angeregt. Oberkörper wippten, Köpfe nickten im Takt. Die Hausband des Theaters um Willy Daum mit Urs Benterbusch, Jonathan Göring, Edgar Herzog und Peter Imig setzte sich groß ein, wenn auch ihr Sound eher als rockiger Jazz abzuhaken und im Klang sehr tastenlastig und laut war. Doch einmal gab es auch ein Duett zwischen Gesang und Mundharmonika und ein Gitarrensolo, so wie Bob es mochte. „The Times They Are a-Changin’“ war dabei, und „Blowin’ in the Wind“ natürlich, auch „Like A Rolling Stone“ und vieles mehr, von dem man gern Titel gewusst hätte. Aber die Macher dieser Show schienen sich an ein Dylan-Fan-Publikum wenden zu wollen, bei dem jeder jeden Text kennt und alles goutiert. Sie gingen mit, klatschten am Schluss stehend und jubelten fast eine Viertelstunde um Zugaben.

Wer gekommen war, etwas über den Nobelpreisträger zu erfahren, weil er vielleicht nicht Gelegenheit genug hatte, alles von ihm zu kennen, war auch darin enttäuscht, dass es kein Programmheft gab, nicht einmal einen Zettel, der die Songs und ihre Interpreten und die Macher dieser Show auflistete. So kann auch nicht die ansprechende Bühnengestaltung oder das Lichtdesign zugeordnet werden. Schade.
Fotos: (c) Thorsten Wulff