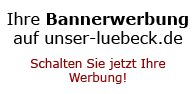Das Lübecker Publikum, mit großem Tanztheater nicht gerade verwöhnt, darf sich wieder einmal an den Tanzkünsten des Kieler Balletts erfreuen. Nun war es „Giselle“, die Tanzschöpfung, die den Ruf hat, eine der anspruchsvollsten im Bereich der klassischen Tanzkunst zu sein.
Sie steht und stand mit dem anderen „phantastischen“ Ballett in Konkurrenz, mit „La Sylphide“. Neun Jahre war dessen Wirkung im Paris des 19. Jahrhunderts so dominant, dass Zeit vergehen musste, bevor dort eine weitere Kreation bestehen konnte. Ganz ähnlich ist es geblieben. Die Reihenfolge hat sich in Kiel und Lübeck nur etwas verkürzt. 2019 brachte die Kieler Truppe in Lübeck das Geister- oder Elfenwesen „Sylphide“ auf die Bühne, jetzt, am 27. September 2025, also nur sechs Jahre später, folgte „Giselle“, die bereits im Januar des letzten Jahres in Kiel ihre Premiere hatte.
 Keito Yamamoto (Giselle) und Ensemble, Foto: Olaf Struck
Keito Yamamoto (Giselle) und Ensemble, Foto: Olaf Struck
Auch wenn ein paar Parallelen zwischen den beiden Werken zu erkennen sind, so ist auf jeden Fall hier die Titelfigur kein Geisterwesen mehr, - zumindest anfangs nicht. Als Weinbauerntochter lebt Giselle mit ihrer Mutter in einem rheinischen Dorf, wo es beim Erntefest munter zugeht, mit Liebe- und Eifersüchteleien und anderen Ein- und Zwietrachten. Dabei ergibt sich ganz natürlich die Tanzlust als ein Handlungsmotiv, die von früher Kindheit an etwas ungleich beiden Geschlechtern mitgegeben ist. Dennoch ist es für das Libretto, das im Wesentlichen von dem vielseitigen romantischen Schriftsteller Théophile Gautier (1811-1872) geprägt ist, ein zentrales Motiv, wie es auch jeden aus der Sparte Ballett antreibt: Giselle ist das Tanzen die größte Lust - trotz einer körperlichen Indisposition. Ihre Mutter bangt um sie wegen ihres schwachen Herzens. Hier greift ein anderes Motiv in die Erzählung ein, eines, das Heinrich Heine (1797-1856) Gautier übermittelt hatte. Er kannte aus der Mythologie die Wilis. Das sind Bräute, die starben, bevor sie vor den Altar treten konnten. Sie mussten nun jede Nacht als Wilis ihre Tanzleidenschaft aus“leben“, auch wenn sie ihre männlichen Partner damit in den Tod lockten. Nur das Tageslicht konnte sie retten.
 Keito Yamamoto (Giselle), Vitalii Netrunenko (Albrecht), Foto: Olaf Struck
Keito Yamamoto (Giselle), Vitalii Netrunenko (Albrecht), Foto: Olaf Struck
Erzählt der erste Akt des Balletts zunächst noch von den Lebenden, vom Dorftreiben mit Ernte und Erntetanz, von Giselle und ihrer besorgten Mutter Berthe, dann von dem inkognito auftretenden Herzog Albrecht, der mit seinem Verwalter oder Knappen Wilfried angereist war, um die bereits dem Wildhüter Hilarion versprochene Giselle zu gewinnen, so steigern sich die Probleme im Laufe der Handlung vor allem für Albrecht. Denn die ihm zugedachte Bathilde erscheint bei einem Jagdevent samt Vater, einem kurländischen Prinzen. Diese Zuspitzung muss aus dramaturgischen Gründen sein, weil am Ende des ersten Aktes für Giselle das Geheimnis um ihren Geliebten gelüftet wird. Ist es nur eine bittere Enttäuschung, ein Gefühl der Minderwertigkeit oder einer Kränkung, was ihr alle Lebenskraft raubt? Sie stirbt und hinterlässt einen verzweifelten, sich schuldig fühlenden Albrecht.
Der mächtige, spätherbstlich kahle Baum, der im ersten Akt den Spielraum nach hinten abschließt, zitiert bereits die Stimmung des nächsten Aktes, wenn der Zuschauer nun in eine mythologische Welt eintaucht, wenn der Tag zur Nacht wird. Ganz zu Beginn wird mit Hilfe der Maschinerie noch ein Zwischenbereich von Ober- und Unterwelt angedeutet. Eva Adler wandelt so ihre feinsinnige Bühnenkonzeption von einem Dorfplatz mit zwei diffus hausartigen Gebilden in eine düstere Fläche, auf der sich das Grab Giselles befindet. Dies ist mit einem Kruzifix versehen, davor weiße Lilien, die Blumen für Unschuld, für Hingabe und Würde. Nach oben begrenzt wieder Großes den Bühnenraum, diesmal ein Astgebilde mit geheimnisvoll herabhängenden Gespinsten, noch mystischer wirkend durch die geschickte Beleuchtung (Martin Witzel). In dieser Szenerie begegnen sich die beiden Liebenden noch einmal, Giselle des Fluches wegen, ihren Geliebten zu Tode zu tanzen, Albrecht, weil er sich dem nicht widersetzen kann. Beide schaffen nicht, Myrtha, die Königin der Wilis, zu erweichen. Wie es vorher bereits an Hilarion vollzogen wurde, hätte auch Albrecht sterben müssen, wenn ihn das Tageslicht nicht davor bewahrt hätte.
 Gulzira Zhantemir (Myrtha, Königin der Wilis), Foto: Olaf Struck
Gulzira Zhantemir (Myrtha, Königin der Wilis), Foto: Olaf Struck
Die grau und braun getönte Bühne wird im ersten Akt durch die lebhaften Töne in der Kleidung von Bauern und Winzern konterkariert. Großartig auch hier, wie Angelo Alberto (Kostüme) das Bild erweitert. Besonders Bathilde und ihr Vater, der kurländische Prinz, fallen als „Exoten“ heraus, womit Albrechts Zuneigung zu Giselle durch seine volkstümliche Verkleidung selbst über die Kostüme bestätigt wird. Der zweite Akt ist allein durch die Wilis geprägt. Hier tragen die Tänzerinnen zwar weiße Kleider, die aber mit schwarzen Spitzenüberwürfen ihren farbpsychologischen Doppelcharakter verraten: das Weiß zieht die Männer an, während das Schwarz das bösartige Gesetz verrät, das sie zum Töten zwingt.
In einer Doppelrolle war Olena Filipieva dabei. Sie hatte die Regie übernommen und gleichzeitig die Rolle der Berthe, Giselles Mutter. Man hatte sich entschlossen, sich an der Originalchoreografie von Jean Coralli, Jules Perrot und Marius Petipa zu orientieren. Das war einleuchtend, dennoch sehr herausfordernd. So erweiterten vor allem im ersten Akt viel Pantomime mit Mimik und Gestik die Ballettsprache. Beträchtliches hatten dabei schon die Tänzer zu leisten. Besonders gelang der Bauern-Pas-de-deux, den Leisa Martínez Santana und Didar Sarsembayev mit Lust und Leichtigkeit ausführten. Im zweiten Akt überwog die tänzerische Attitude noch mehr. Grandioses war dabei bereits Alexey Irnatov als Hilarion gelungen, gesteigert noch durch die Soli und Pas de deux von Keito Yamamoto (Giselle) und Vitalii Netrunenko (Albrecht). Einen starken Akzent setzte Gulzira Zhantemir als Myrtha, Königin der Wilis mit ihrem majestätischen Ernst.
 Keito Yamamoto (Giselle), Vitalii Netrunenko (Albrecht), Foto: Olaf Struck
Keito Yamamoto (Giselle), Vitalii Netrunenko (Albrecht), Foto: Olaf Struck
Der zweite Akt bot damit einen wieder anderen, stilistisch pureren Einblick in die klassisch-romantische Tanzkunst. Aber alles faszinierte das Publikum, das die einheitliche und stimmige Wirkung des Optischen mit seinem langen, ausdauernden Applaus hervorhob, aber auch das Lübecker Orchester herausstellte, das unter Leitung von Jan-Michael Krüger die Farbigkeit der Musik von Adolphe Adam (unterstützt von Friedrich Burgmüller und Ludwig Minkus) gebührend herausstellte. Das Lübecker Publikum zeigte, dass es sich glücklich schätzte, etwas von dem Glanz der Tanzkunst genießen zu dürfen, den das Ballett am Kieler Theater ausstrahlt.
Fotos: (c) Olaf Struck